In meiner Bibliothek gestöbert
Hier stelle ich jeden Monat Bücher aus meiner Bibliothek vor, die mir aus diesem oder jenem Grund wichtig sind. Im Januar 2026 geht es um eine alte Fontane-Ausgabe:
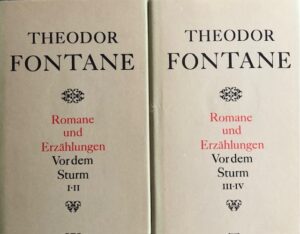 Ich war eben in mein Berufsleben als Zeitungsredakteur (bei den Norddeutschen Neuesten Nachrichten) eingetreten, als ich zwecks Urlaubsvertretung nach Neubrandenburg musste (normalerweise saß ich in Greifswald). Die Abende in Neubrandenburg verbrachte ich mit Westfernsehengucken (ich selbst hatte keinen Fernseher) und Lesen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich zu der zehnbändigen Ausgabe von Fontanes Romanen und Erzählungen aus dem Aufbau-Verlag (für 66 DDR-Mark) gekommen war, aber in Neubrandenburg las ich die ersten beiden Bände, Fontanes ersten und umfangreichsten Roman „Vor dem Sturm“.
Ich war eben in mein Berufsleben als Zeitungsredakteur (bei den Norddeutschen Neuesten Nachrichten) eingetreten, als ich zwecks Urlaubsvertretung nach Neubrandenburg musste (normalerweise saß ich in Greifswald). Die Abende in Neubrandenburg verbrachte ich mit Westfernsehengucken (ich selbst hatte keinen Fernseher) und Lesen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich zu der zehnbändigen Ausgabe von Fontanes Romanen und Erzählungen aus dem Aufbau-Verlag (für 66 DDR-Mark) gekommen war, aber in Neubrandenburg las ich die ersten beiden Bände, Fontanes ersten und umfangreichsten Roman „Vor dem Sturm“.
Von meiner Lektüre weiß ich noch, dass der Roman mich gefesselt hatte und aus dem reichen Figurenensemble vor allem die schöne Kathinka bei mir ein nachhaltiges Bild erzeugte. Jetzt las ich den Roman abermals, abermals gefesselt, aber doch mit etwas anderen Eindrücken. Kathinka ist ein ziemlich arrogantes Frauenzimmer – habe ich das damals überlesen oder hat das Leben mein Frauenbild verändert?
Deutlich mehr hervor traten diesmal Figuren wie die verwachsene, hexenhafte Hoppenmariken, der geradlinige, aber schon etwas aus der Zeit gefallene Berndt von Zitzewitz, seine grandios aufrecht durch das Leben schreitende Schwester, der alte preußische General Bamme in seinen Selbstzweifeln und der germanische Altertümer, falsche wie echte, sammelnde Pastor Seidentopf.
Blass einmal mehr blieben die Hauptfiguren Lewin, Renate und Marie. Und was Lewin und Marie am Ende zu ihrer Liebe führt, vor allem was Marie an Lewin findet – keine Ahnung. Nun, „Vor dem Sturm“ hat so einige Schwächen, nicht zuletzt das in jeder Hinsicht Ausufernde. Aber wer selbst Romane schreibt, zeigt Nachsicht, weil er weiß, wie schwer es fällt, sich von seinen Figuren wieder verabschieden zu müssen – nach oft jahrelangem intensivem Umgang miteinander.
Damals in Neubrandenburg, erinnere ich mich, störten mich die vielen poetischen Einlagen, diesmal haben sie mich bezaubert. Vor allem die Grabinschrift, die Lewin, am Weihnachtsabend 1812 von Berlin ins Oderbruch, seine Heimat, reisend, zufällig in einer Kirche liest und die wie ein Motto über dem Roman steht: „Sie sieht nun tausend Lichter, der Engel Angesichter ihr treu zu Diensten stehn, sie schwingt die Siegesfahne auf güldnem Himmelsplane und kann auf Sternen gehn“
„Auf Sternen gehn“ – wundervoll. Das tun auch alle Romane Fontanes.

